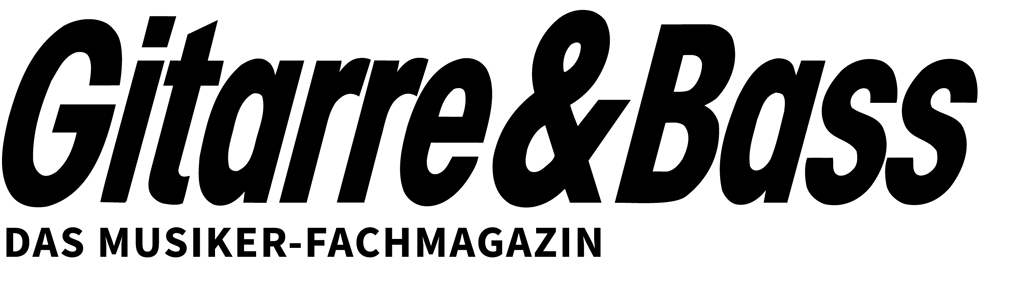Die Firmengeschichte von Rickenbacker
American Dream
Wie bei so viele legendären amerikanischen Gitarrenherstellern beginnt auch diese Geschichte in Europa. Namensgeber Adolph Rickenbacher erblickte im April 1886 in Basel das Licht der Welt, kam aber schon in jungen Jahren mit seiner Familie in die Vereinigten Staaten, und lebte zunächst in Ohio und später in Illinois, bis er sich 1918 endgültig in Los Angeles niederließ.
Hier in Kalifornien begann er seine Karriere: zunächst als Zulieferer von Metall- und Plastikteilen für eine breit gestreute Klientel. Schon Ende der 20er Jahre machte die Zuarbeit für Gitarrenhersteller einen profitablen Teil der Aktivitäten der aufstrebenden Firma Rickenbacher aus.

Die Hochzeit mit Charlotte, deren Familie in Pennsylvania im Ölgeschäft tätig war, stärkte Adolphs finanzielle Position, und die erfolgreiche Zusammenarbeit mit der benachbarten National String Instrument Corporation, für die Rickenbacher Metall-Bodys und Resonatoren herstellte, führte zu einem größeren Engagement Adolphs im Gitarrenbau.
Ende der 20er Jahre hatten Musiker und Gitarrenhersteller nur eins im Sinn: der Gitarre eine größere Lautstärke zu verleihen, da sie sich in den immer lauter werdenden Bands und Orchestern selbst als Rhythmus-, und schon gar nicht als Solo-Instrument, nicht mehr durchsetzen konnte. National hatte sich dem „Ampliphonic Resonator“-Prinzip verschrieben, das mehr Klang-Volumen aus einem neuartigen resonanzgebenden Aluminiumkegel versprach, der in die Gitarre eingebaut wurde.

John Dopyera, der Kopf von National Guitars, wurde durch den Vaudeville-Gitarristen George Beauchamps, der mit seinen bahnbrechenden Ideen eines Tages im Geschäft der Familie stand, auf das Problem und die technischen Möglichkeiten aufmerksam. Daraus entwickelte sich eine Zusammenarbeit, die letztlich auch Adolph Rickenbacher in die Aktivitäten einbezog.
Nicht nur das – mit Beauchamps betrat ein heller Kopf die Szene, der mit den begrenzten Möglichkeiten der Resonator-Verstärkung nicht zufrieden war und weiterdachte. Seine Idee war: „Wenn man Radiowellen verstärken kann, warum dann nicht Schwingungen?“ Obwohl inzwischen General Manager bei National, ließ ihn die Idee der elektrischen Verstärkung von Saiteninstrumenten nicht mehr los, und mit der Unterstützung von Paul Barth, einem Kollegen bei National, entwickelte er den Prototypen eines elektromagnetischen Pickups für Gitarre.
Den Beweis seiner Theorien lieferte ihm der Tonabnehmer eines Brunswick-Plattenspielers, den er ausgebaut und mit verlängerten Drähten auf einen Holzblock mit nur einer Saite darauf montiert hatte. Mit Hilfe des Motors seiner Waschmaschine wickelte er alsbald seinen ersten Pickup für sechs Saiten. Zusammen mit einem weiteren Ex-National-Mann, Harry Watson, bauten die ruhelosen Erfinder nach vielen Experimenten letztlich die berühmte „Frying Pan“, eine Lap-Steel-Guitar aus Ahorn, die aus einem langen Hals mit kleinem kreisrunden Korpus bestand, was tatsächlich dem Bild einer „Bratpfanne“ recht nah kam.

Zwei kräftige Hufeisenmagneten, in die eine Spule eingebettet war, umschlossen effektiv die Saiten und – es funktionierte. Obwohl zu dieser Zeit eine ganze Reihe von Tüftlern und an dem Prinzip der elektromagnetischen Klangwandlung arbeiteten, handelte es sich bei der Frying Pan um das erste funktionstüchtige Modell. Wenn man so will, ist die Frying Pan die Mutter der E-Gitarre. Heute befindet sich dieser Prototyp im Rickenbacker-Museum in Santa Ana, Kalifornien.
Beauchamp, Barth und Rickenbacher gründeten Ende 1931 gemeinsam die Ro-Pat-In Company, um ihre Ideen auch in eine Produktion umzusetzen. Dies hatte umgehend zur Folge, dass Beauchamp und Barth bei National gefeuert wurden. Schwierigkeiten gab es zunächst auch mit den amerikanischen Patent-Behörden, die ein Patent verweigerten, weil sie an der praktischen Durchführbarkeit der Konstruktion zweifelten. Also schickte man einige Musiker, unter ihnen der berühmte Sol Hoopii aus Hawaii, nach Washington, um den Patent-Wächtern praktische Beweise für die Funktionstüchtigkeit des „Horseshoe Pickup“ zu liefern.

Mit Erfolg – nur Tage nach der Demonstration wurde mitgeteilt, dass das beantragte Patent veröffentlicht werde. Bereits im Sommer 1932 begann Ro-Pat-In mit der Produktion von Lap-Steels mit „Horseshoe-Pickups“ aus Alu-Guss und war damit der erste Hersteller von realen E-Gitarren in Serienfertigung. Zwei Modelle kamen heraus, die A22 und die A25 mit längerer Mensur.
Obwohl die Verkäufe mäßig waren und es wegen des Aluminiums Probleme mit der Stimmstabilität gab, ist die historische Bedeutung immens. Man muss sich nur einmal vor Augen führen, dass große Hersteller wie Gibson und Epiphone erst Mitte der 30er Jahre begannen, ihre Akustikgitarren mit einer zusätzlichen Elektrik aufzupeppen – Ro-Pat-In stellte jedoch von Anfang an ausschließlich E-Gitarren her.
1934 wurde der Firmenname in „Electro String Instrument Corporation“ geändert, und das Logo erhielt erstmals den Zusatz Rickenbacher, später dann die anglisierte Form Rickenbacker. Obwohl jahrelang viel Arbeit und rund 150.000 Dollar investiert wurden, ging die Entwicklung der Firma nicht voran – die Skepsis der Musiker gegenüber den neuen Instrumenten und den damals noch recht anfälligen Verstärkern war zu groß.

Auch „richtige“ Gitarren, die seit 1932 mit Holzbodys, die die Firmen Kay und Harmony zulieferten, gebaut und dann in Los Angeles mit dem Horseshoe-Pickup ausgestattet wurden, wollte niemand so recht haben. Ein technisches Problem konnte man immerhin lösen: Das besonders unter dem heißen Bühnenlicht instabile Aluminium wurde gegen das erste synthetische Kunststoffmaterial Bakelit ausgetauscht, aus dem z. B. auch Bowling-Kugeln hergestellt wurden. Diese harte und hitzebeständige Phenol-Verbindung wurde ab 1935 für den Bau der Lap-Steel-Gitarren, aber auch der Electro-Spanish-Version Model B verwendet.
Allerdings musste der Hersteller zunächst eine Lizenz für den Guss von Instrumentenhälsen und -bodies vom englischen Patentinhaber Arthur Primrose Young erwerben – typisch für diese Zeit. Während die Hawaii-Modelle aus Bakelit sich nun endlich verkauften (und noch heute als besonders gute und begehrte Instrumente gelten), kam die Spanish Bakelite, die erste Solidbody-Gitarre überhaupt, nur auf enttäuschende Verkaufszahlen.

George Beauchamp, der hellsichtige Innovator, verlor schon nach ein paar Jahren das Interesse am Gitarrengeschäft und verkaufte 1940 seine Anteile an der Firma Electro. Paul Barth übernahm nach Beauchamps Ausstieg die Verantwortung für die Instrumentenproduktion, die aber dann im Sommer 1942 zugunsten von Rüstungsgütern eingestellt werden musste. Immerhin konnte man die vom Zweiten Weltkrieg erzwungene Pause im Instrumentenbau für eine Vergrößerung der Fabrikgebäude in Los Angeles nutzen.
Neue Zeit
Nach dem Krieg nahm die Electro String Company ihre Arbeit wieder auf, aber Adolphe Rickenbacker, der 1946 seinen 60. Geburtstag feierte, verlor mehr und mehr das Interesse am Instrumentenbau. Er widmete sich später nur noch seinem angestammten Zulieferergeschäft und verkaufte letztlich die Firma Electro einschließlich der unbegrenzten Nutzungsrechte des Markennamens Rickenbacker an einen gewissen F.C. Hall.
Francis Hall hatte in den 30er Jahren eine Vertriebsgesellschaft für elektronische Bauteile (Radio & Television Equipment Co. – kurz: Radio-Tel) gegründet und stand in Lieferkontakt mit dem von Doc Kauffman und Leo Fender betriebenen Radiogeschäft K&F, das bald in Fender Electric Instruments Co. umbenannt werden sollte und dank der Telecaster und des Precision-Basses ab 1953 in aller Munde war.
Hall definierte unter diesem Eindruck die Ziele von Electro/ Rickenbacker neu, und 1956 zog man um nach Santa Anita – in die unmittelbare Nachbarschaft zu Fender Sales. Die Rickenbacker-Instrumente entwickelten jedoch erst mit dem Engagement des Deutschen Roger Rossmeisl Anfang 1954 ihr eigenes Profil. Rossmeisl lernte den Gitarrenbau bei seinem Vater Wenzel, der ab 1935 in der Nähe von Kiel, nach dem Krieg auch in Berlin, unter dem Markennamen Roger Jazz-Gitarren baute.
1952 war Roger Rossmeisl nach Amerika ausgewandert, um für Gibson in Michigan zu arbeiten. Ted McCarty hatte die Schiffs-Passage bezahlt, aber so richtig warm ist Roger Rossmeisl mit Gibson nicht geworden – er blieb nur etwa ein Jahr bei der altehrwürdigen Firma. Nach einem Engagement als Gitarrist auf einem Kreuzfahrtschiff nach Hawaii bewarb er sich bei Electro und wurde eingestellt.
Noch im Laufe des Jahres 1954 trat Electro mit seinen „modernen“ Modellen Combo 600 und Combo 800 unter dem Namen Rickenbacker an die Öffentlichkeit. Man nimmt an, dass Rossmeisl für das Korpus- und Hals-Design verantwortlich war, das mit seinen zwei Cutaways und der gewölbten Decke noch schon unverkennbar die Züge der Rickenbacker-Linie trägt.
Das Design der verschiedenen Combo-Modelle war zunächst gleich, aber in der Ausführung gab es gehörige Unterschiede: manche hatten geleimte, andere geschraubte Hälse; der eine Korpus war massiv gearbeitet, der andere zeigte rückseitige Ausfräsungen, auch später noch ein firmentypisches Konstruktionsmerkmal.
Selbst das unterstrichene Firmenlogo auf langer spitzer Kunststoffzunge am Kopf hatte schon das noch heute verwendete Erscheinungsbild. Während die ersten Combo-Gitarren noch mit Horseshoe-Pickups ausgestattet waren, wurden schon bald etwas eleganter aussehende Tonabnehmer à la Gibson, Gretsch oder Harmony entwickelt, die ab 1956 zuerst auf dem neuen Combo- 400-Modell Verwendung fanden.

Die 400 wies neben der neuen „Tulpen“-Form noch ein Novum auf, das vorher nur in historischen Einzelstücken wie der Bigsby-Travis-Gitarre (gebaut 1947/48) zu finden war: die durchgehende Halskonstruktion, welche auch später noch von Bedeutung sein sollte. Die Geschäfte zogen langsam an, und Rossmeisl & Co. entwarfen weitere Modell-Varianten.
So wurde ab 1957 das untere Cutaway bei den neuen Modellen 900 und 950 mit Dreiviertel-Mensur konkav gestaltet, um die hohen Lagen besser erreichbar zu machen – eine Eigenschaft, die auf alle anderen Typen übertragen wurde. Im gleichen Jahr erschien noch ein Gitarrendesign, das bis heute die Erscheinungsform von Rickenbacker-Gitarren prägen sollte. Die zeitlos elegante Form der Combo-650- und Combo-850-Gitarren zeichnet sich durch einen kleinen Korpus mit der bekannten „Sweeping Crescent“-Silhouette aus; auch der doppelte Hals-Stahlstab kam hier erstmals zum Einsatz.
Rossmeisl & Halls Katze
1958 sollte dann zu dem Jahr werden, in dem der Grundstock zum großen Erfolg in den 60er Jahren gelegt wurde. Roger Rossmeisl, der wunderliche Einzelgänger und geniale Designer, lief jetzt zur Hochform auf. Ein großer Wurf gelang ihm z. B. mit der Konstruktion der semiakustischen Capri-Serie, benannt nach der Katze seines Brotgebers Hall.
Abseits der traditionellen Methode wurde ein in der Regel aus zwei Blöcken zusammengeleimter Ahornkorpus rückseitig teilweise ausgefräst und nach der Installation der Elektronik mit einem Holzdeckel verschlossen. Hiernach wurde erst der Hals eingeleimt. Diese Methode ist eine bis heute nur von Rickenbacker praktizierte originelle Bauweise.
Gleich das erste Modell, die Capri 325 mit kleinem Korpus und 3/4-Hals sollte Geschichte schreiben, denn John Lennon wählte dieses Instrument zu seinem Arbeitsgerät. Immerhin wurden in Rickenbackers Preisliste im Juni 1958 bereits 12 Modelltypen, teils nun auch mit „Full Necks“ und breit gefächertem Ausstattungsprogramm geführt. Merkmale wie die „Toaster-Top“-Tonabnehmer und zweireihige Pickguards oder die schmalen Hälse mit Dreieckseinlagen, später dann auch lackierte Griffbretter, die heute als klassische Attribute für Rickenbacker gelten, finden sich erstmals bei den Capri-Modellen wieder (nach 1959 verzichtete man auf den Namen).
Ende ‘58 wurde die neue Korpusform „Cresting Wave“ bei den Solidbody-Modellen 425 und 450 vorgestellt, die kurz zuvor bereits dem ersten Bass mit noch einem Pickup, aber schon der bis heute gebräuchlichen Neck-Through-Body-Konstruktion (Modell 4000) ähnliche Konturen gab, die bis heute ihre Gültigkeit und Attraktivität besitzen. Auch das sehr individuelle Design einer Gitarre mit „German Carve“, Modell 381, erblickte in diesem Jahr das Licht der Welt.

Rossmeisl brachte mit dem „deutschen Schnitt“, einer konturierten Kehlung von Decke und Boden, seine Erfahrungen aus dem deutschen Gitarrenbau in die amerikanische Instrumentengeschichte ein. Das gleiche gilt auch für das „Slash-Soundhole“ und die elegante Vertiefung für die Aufnahme der Saitenhalterung auf der Decke.
1960 griff Rickenbacker, wie viele seiner Konkurrenten auch, das modische Zauberwort „Stereo“ auf und schuf den „Rick-O-Sound“, eine Schaltung, die über eine Doppel-Klinkenbuchse (eine normal, die andere stereophon ausgelegt zur Verwendung eines Y-Kabels) getrennte Outputs von Hals- und Stegpickup zur Verfügung stellte. Der Erfolg dieser Pseudo-Stereo-Schaltung blieb allerdings aus.
1961 stellte man mit der 460 eine Deluxe-Version der 450 mit einem erstmals verwendeten fünften Blend-Regler vor, der bei Einzelschaltungen der Pickups die jeweilige Zumischung von etwas Signal des nicht angewählten Tonabnehmers zuließ.
1962 verlegte das Unternehmen seinen Sitz ins südlichere Santa Ana, in die Nähe des Hauptquartiers von Radio-Tel. Kurz nach dem Umzug verließ Roger Rossmeisl die Firma – ein herber Verlust. Er wechselte zu Fender, wo er für die Arbeit an einer neuen Reihe von Akustikgitarren engagiert wurde. Roger Rossmeisl blieb bis 1968 bei Fender und kehrte dann nach Deutschland zurück, wo er 1979 im Alter von 52 Jahren starb.
John Lennons 325
Als die Beatles 1960 nach Hamburg kamen, um ihr immerhin 48 Nächte umfassendes Engagement im Indra-Club anzutreten, hatten sie nur so etwas wie eine Notausrüstung dabei. Wie fast alle Bands zu dieser Zeit spielten die noch völlig unbekannten Jungs aus Liverpool billige Instrumente europäischer Produktion mit Namen wie Rosetti, Neoton Grazioso etc. John Lennon selbst hatte eine Höfner Club-40.
Das Engagement machte es möglich, über neue, bessere Gitarren nachzudenken. Mutmaßlich hat John „Toots“ Thielemans in Hamburg spielen sehen, kannte aber zumindest ein Platten-Cover mit „Toots“ und seiner Rickenbacker. Jedenfalls ging John kurz darauf in Begleitung von George in den Hamburger Musikladen Karl-Heinz Weimer (später Music City) auf der Reeperbahn und erstand dort seine berühmte Capri 325, die er von 1960 bis 1964 als Hauptgitarre im Studio und auf der Bühne spielte.

George Harrison berichtet, dass der Handel etwa so ablief: „Anzahlung, und den Rest, wenn sie dich kriegen.“ Ob sie wohl jemals ganz bezahlt wurde, ist nicht überliefert. Nach Deutschland eingeführt und später dann nach Hamburg geliefert hatte das Instrument mit der Seriennummer V81 übrigens Fred Wilfer, der seinerzeit in Bubenreuth die Framus-Werke betrieb.
Eine Radio-Tel Rechnung vom 15. Oktober 1958 weist den Import zu einem Lieferpreis von $ 96,50 aus. Heute vertreibt übrigens Warwick/Framus-Chef Hans-Peter Wilfer, Fred Wilfers Sohn, die Instrumente von Rickenbacker in Deutschland.
Beatlemania
Für Rickenbacker sollte dieser Kauf zum glücklichsten Umstand in ihrer Firmengeschichte werden. Als ab 1963 die Popularität der „Liverpoodels“ sprunghaft anstieg, bemühten sich gleich mehrere englische Firmen um den Vertrieb von Rickenbacker-Gitarren. Das Rennen machten Roy Morris und Maurice Woolf von Rose-Morris nach einem Besuch in Santa Ana, wo sie nicht nur gleich 450 Gitarren bestellten, sondern auch den Kontakt zu Beatles-Manager Brian Epstein einfädelten.

Als F.C. Hall dann hörte, dass die Beatles im Februar 1964 für drei Konzerte und einen Auftritt in der Ed-Sullivan-Show in die USA kommen würden und überdies gerade die Single-Charts anführten, arrangierte er unter strenger Geheimhaltung ein Treffen im Savoy Hilton in New York.
Leider war George kurzfristig erkrankt und hütete das Bett im nahegelegenen Plaza-Hotel, aber als John die neuentwickelte 12String 360/12 sah, forderte er Hall auf, ihn zu George zu begleiten, um ihm das Instrument zu zeigen. George war sofort begeistert von dieser Gitarre, die sich u. a. mit solch interessanten Detaillösungen wie der versetzten Anordnung der Mechaniken von Konkurrenzfirmen wie Gibson und Fender wohltuend abhob und später als erfolgreichste 12-String-Gitarre in die Geschichte der Rock- und Popmusik eingehen sollte.
Auch John bekam eine neue schwarze 325 und spielte sie schon beim zweiten Live-Termin acht Tage später im Deauville-Hotel in Florida, das als Fernseh-Show ausgestrahlt und von vorher nie erreichten 70 Millionen Zuschauern gesehen wurde. Die 12String kam sofort nach der Rückkehr der Fab Four in den Abbey-Road-Studios der EMI zum Einsatz. Zunächst spielte George sie auf ,You Can’t Do That’ und etwas später dann auf ,A Hard Days Night‘ mit jenem berühmten charakteristischen Eröffnungsakkord.

Als die Beatles Ende August für weitere Konzerte in die USA reisten und John und George in der Hollywood Bowl gleich den ersten Song ,Twist And Shout‘ mit ihren Rickenbackers spielten, wird F.C. Hall, der mit seinem Sohn John unter den Zuhörern war, große Genugtuung gefühlt haben. Der britische Vertrieb profitierte natürlich sehr von der enormen Popularität der Beatles, allerdings mochte Roy Morris die „Slash“- Schall-Löcher nicht besonders und orderte traditionelle F-Löcher für die halbakustischen Instrumente, die dann ab 1964 ausgeliefert wurden; diese Export-Versionen sind heute in Sammlerkreisen recht gefragt.
Der Höhepunkt
Die Werbewirkung der musikalisch allgegenwärtigen Liverpooler für Rickenbacker war immens, und man baute schon bald ein neues drittes Fabrikgebäude in Santa Ana, um die sprunghaft gestiegene Nachfrage befriedigen zu können. Viele Bands eiferten dem erfolgreichen Sound der Beatles nach, und einigen verhalf es tatsächlich zum Durchbruch.

Die Byrds gehörten z. B. zu den Bands, die sich per Kredit komplett mit dem Beatles-Instrumentarium ausstatteten, nachdem sie den Film ,A Hard Days Night‘ gesehen hatten. Der Erfolg gab ihnen recht, denn gleich die erste Single ,Mr. Tambourine Man‘, in der Roger McGuinn mit Hilfe der 360/12 seinen berühmten „Jingle-Jangle“-Sound präsentierte, wurde Mitte 1965 zu einem großen Hit.
Mehr noch als bei den Beatles wurde der Sound der Rickenbacker-12String ein Markenzeichen der Byrds und Roger McGuinns. In England waren es Gruppen wie The Who, die mit Rickenbackers hantierten – allerdings nicht immer so, dass es den Instrumenten gut bekam. Pete Townshend sorgte auf seine Art für Umsatz, indem er Dutzende von Rickenbackers auf offener Bühne zerschmetterte und so eine gewisse Popularität in der Londoner Clubszene erlangte.
Derweil lief die Produktion bei Rickenbacker auf höchsten Touren. Bis zu sechs Monate Wartezeit musste die Kundschaft in Kauf nehmen, und die Belegschaft erreichte zwischen 1965 und 1968 den Spitzenwert von 103 Mitarbeitern. Auch zeigte man sich aufgeschlossen für Neuerungen, die sich in solch eigenartigen Erfindungen wie dem „String Converter“ niederschlugen. Mit diesem Converter-Kamm konnten bei einer 12String einige oder alle paarigen Saiten aus dem Spiel genommen werden – „zwei Gitarren in einer“ hieß es in der Werbung.
Man begann mit schräg eingesetzten Bünden zu experimentieren und erreichte den Gipfel des Skurrilen wohl mit der „Lightshow-Guitar“ von 1970, die unter einer durchsichtigen Kunststoffdecke eine Lichtorgel mit vielen, von der gespielten Tonhöhe gesteuerten, bunten Lämpchen barg.
Ernüchterung
Die Zeit allerdings hatte die Weichen bereits in eine andere Richtung gestellt, und der Publikumsgeschmack wandelte sich. Psychedelische Musik war angesagt, deren Protagonisten Hendrix und Clapton mit verzerrten Klängen von Strats und Les Pauls für neue klangliche Trends sorgten. Rickenbacker-Gitarren haben dagegen ihre Stärken in den klaren Sounds und schienen für die neue Mode nicht geeignet.
Tatsächlich kamen in der Rickenbacker-Geschichte nur selten satter klingende Humbucker-Pickups zum Einsatz, z. B. auf dem John-Kay-Modell von 1988 und in der Kombination mit zwei Singlecoils auch im Susanna-Hoffs-Modell. Später, ab 1992 versuchte John Hall dem Image der Rhythmusgitarre zu entkommen und brachte die 650 mit HB heraus. Auch die 230 Hamburg und 250 El Dorado bekamen die gleichen Humbucker der John-Kay-Gitarre.
Dazu hatten sich mittlerweile die Beatles aufgelöst, und die neuen Modelle der kalifornischen Firma erzeugten wenig bis gar keine Begeisterung. So kam es unweigerlich zu einem Absturz der Verkaufszahlen, und die Anzahl der Beschäftigten sank von ca. 100 in der Glanzzeit auf beängstigende acht (!) zwischen 1969 und 1971.
Wäre in jener Zeit nicht der Rickenbacker-Bass durch Paul McCartney und Chris Squire von Yes in Mode gekommen, hätte die Firma wohl ihre Tore schließen müssen.
Vintage & Signature
Die 70er Jahre brachten wenig Bemerkenswertes, einige Versuche mit Solidbodys etwa und gewichtige Doppelhalsgitarren wie die 4080/12 oder 362/12 Modelle. Aber immerhin überlebte die Firma.
Mit der Übernahme der Geschäfte durch John Hall Jr. im Jahr 1984 änderte sich auch die Firmenpolitik. Hilfreich für ein neues Selbstbewusstsein war nicht zuletzt der inzwischen erblühte Vintage-Markt, auf dem alte Rickenbacker-Modelle respektable Preise erzielten.
Hall Jr. reorganisierte den Vertrieb und brachte noch im gleichen Jahr ein Vintage-Reissue-Programm mit Replikas der bekanntesten Modelle 325 und 360/12 heraus. Anders als der halbherzige erste Versuch von 1983 mit eher mäßigen Ergebnissen ging die Rechnung nun auf. Hinzu gesellte sich noch das neue Marketing-Konzept von Signature-Gitarren.
In Zusammenarbeit mit berühmten Gitarristen wurden Instrumtente entwickelt, die den Namen des Gitarristen trugen. Ausgerechnet Pete Townshend, der in den 1660er Jahren so viele Rickys öffentlich geschlachtet hatte, wurde 1987 zum Namensgeber des ersten, auf 250 Stück limitierten Signature-Modells, das auch prompt innerhalb von sechs Wochen ausverkauft war und deshalb gar nicht erst in Katalogen oder auch nur Preislisten auftauchte.
Heute umfasst das Rickenbacker-Programm eine umfangreiche Palette von in erster Linie klassisch orientierten Modellen, die alle die Handschrift ihres legendären Designers Roger „Ross“ Rossmeisl tragen.
Das Video gibt einen Einblick in die Produktionsabläufe bei Rickenbacker:
In der modernen Musikgeschichte hat dieser Hersteller eine Nische gefunden, in der die typischen Klangfarben seiner Instrumente einen beständigen Platz gefunden haben und ihm den Weg zurück in die Zukunft hoffentlich noch lange begehbar halten.
Und zum Schluss gibt es noch einen Vergleich von zwei aktuellen Modellen auf die Ohren:
Wer spielt Rickenbacker?
Eine neue Gitarristen-Generation brachte Rickenbacker in den 1980ern wieder ins Gespräch. Peter Buck von R.E.M, Johnny Marr von The Smith und Paul Weller von The Jam ließen die Rickys wieder klingen.
Hierzulande spielte sich die Band Kraan mit ihrem Plektrum-Bassisten Hellmut Hattler durch die Clubs der Republik – mit einem brillant klingenden Rickenbacker-4001-Bass.
Berühmte Musiker, denen namentlich Instrumente gewidmet wurden, sind neben Pete Townshend Roger McGuinn (1988), John Kay (1988), Susanna Hoffs (1988), John Lennon (1989), Tom Petty (1991), Chris Squire (1991) und Glenn Frey (1992). Nahezu alle diese Serien sind mittlerweile ausverkauft und nur noch auf dem Second-Hand-Markt zu bekommen.
In dem Noisey Interview spricht auch Lemmy Kilmister über seinen geliebten Rickenbacker Signagture Bass:
https://www.youtube.com/watch?v=G14VN_H8mUk
Autor: Franz Holtmann (erschienen in Gitarre & Bass 04/2001)
Du möchtest wissen, wie Rickenbacker Instrumente in unseren Testberichten ausfallen oder andere spannende Hintergrundberichte und News zu der Brand erfahren? Dann hol dir ein Abo von Gitarre & Bass!