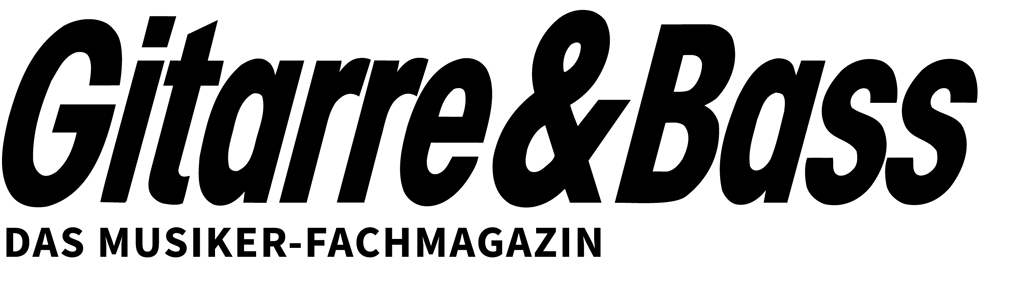Was ist das Erfolgsgeheimnis von Marcus Miller?
Elegante Technik, versiertes Timing, gereifter Ton und das schier unerschöpfliche Reservoire an Ausdrucksmöglichkeiten sind bei Marcus Miller das Resultat jahrzehntelanger Erfahrung.
Was ist Millers Erfolgsgeheimnis? Er selbst betont, dass er immer nur kompromisslos das gespielt habe, was ihm sein Gehör „einflüsterte“ (da dürfte der Einfluss seines musikalischen Ziehvaters Miles Davis nicht unwichtig gewesen sein).
Marcus Miller – dieser Name steht für Musik, die auf besondere Weise Funk-Grooves und Jazz-Harmonien zusammenbringt. Millers Klang- und Rhythmus-Architektur ist das wohl intelligenteste Beispiel für eine perfekte Balance von kühlem Intellekt, treibendem Groove und gnadenlosem Temperament. Doch lassen wir Marcus selbst zu Wort kommen:
Marcus Miller über …
Marcus Miller über seine Karriere
Ich wurde am 14. Juni 1959 in Brooklyn geboren und wuchs in Jamaica/NY auf. Musik war in meiner Familie immer präsent, mein Vater spielte die Orgel in der Kirche und war Chorleiter. Zum weiteren Kreis meiner Verwandtschaft gehörte übrigens auch Wynton Kelly, der für Miles Davis in den 50ern und 60ern Klavier spielte. Richtig infiziert wurde ich von Rhythm & Blues. Erst lernte ich Klarinette, mit 15 bekam ich meinen ersten Bass und spielte ziemlich bald professionell in New Yorker Clubs.
Ein Jahr später spielte ich mit dem Flötisten Bobbie Humphray und dem Keyboarder Lonnie Liston Smith und komponierte bereits erste eigene Stücke. Die nächsten Jahre verbrachte ich in New Yorker Studios, wo ich Gelegenheit hatte, für viele großartige Künstler zu spielen. Ich glaube, ich habe mehr als 400 Platten eingespielt.
1980 kam dann die Gelegenheit, zum ersten Mal mit Miles Davis zu arbeiten; ich war etwa zwei Jahre mit ihm auf Tour. Mein erster Job als Produzent war David Sanborns ‚Voyeur‘. Diese Platte und auch die 2000er-Produktion ‚Inside‘ konnten einen Grammy gewinnen. Auch die Zusammenarbeit mit Luther Vandross begann in den 80ern. 1986 konnte ich wieder mit Miles spielen und produzierte ‚Tutu‘, außerdem war ich an Aufnahmen von Al Jarreau, Chaka Khan, den Crusaders und Take Six beteiligt. Meine ersten beiden Alben unter eigenem Namen waren ‚Suddenly‘ und ‚Marcus Miller‘ aus den 80ern; danach kamen ‚The Sun Don’t Lie‘, ‚Tales‘, ‚Live And More‘ und ‚M Squared‘.

Marcus Miller über sein Equipment
Mein wichtigstes Instrument ist ein 77er Jazz-Bass, den ich seit Mitte der 70er Jahre spiele. Ich bin fast sicher, dass ich ihn 1976 gekauft habe, aber jeder Experte sagt, es muss ein 77er sein – ich bringe da wohl die Daten durcheinander. Mit diesem Instrument bin ich innig verbunden, und ich habe kaum auf anderen Bässen gespielt, abgesehen von den Fretless-Instrumenten natürlich.
Gleich welche Stilistik, ich habe mich damit immer wohl gefühlt. Ich spiele nicht nur praktisch ausschließlich Viersaiter, sondern bin wirklich auf diesen Bass fixiert. Ich habe auch schon Fünfsaiter ausprobiert, war aber nie ganz glücklich damit. Generell mag ich neue Instrumente nicht so sehr.
Auf dem NAMM 2018 hat Marcus neues Gear vorgestellt:
Ich setze keine besonderen Preamps oder spezielle Effekte ein. Für manche Bassisten ist der Klang direkt in den Mixer zu sauber, doch ich komme gut damit klar. Es gab Zeiten in New York, zu denen ich unzählige Sessions spielte und von Studio zu Studio eilte. Da war keine Zeit, noch großartig Amps mitzunehmen aufzubauen.
In den 80er Jahren spielte ich manchmal fünf oder sechs Recording-Sessions am Tag. Ich würde sagen, dieser direkte Bass-Sound ist „mein Sound“. Jeder Take auf CD, den du von mir hören kannst, wurde so aufgenommen.
Marcus Miller über Saxofon, Klarinette und Gitarre
Du willst wissen, wie die Tatsache, dass ich neben meinem Hauptinstrument auch Saxofon, Bass-Klarinette, Keyboards und Gitarre spiele, mein Bass-Spiel beeinflusst? Nun, es lässt mich melodiöser spielen, es fördert mein Verständnis für melodische Abläufe und die speziellen Eigenarten anderer Instrumente. Das bringt mich als Bassist dazu, passender und angemessener zu spielen. Viele Bassisten haben keine rechten Einschätzung, wie ihr eigenes Instrument mit dem Rest der Gruppe zusammenarbeiten und harmonieren soll.

Marcus Miller spielt auch Saxophon
Die Beschäftigung mit anderen Instrumenten ist eine große Hilfe und Bereicherung. Besonders das Klavier gibt dir ein gutes Gefühl dafür, wo du mit dem Bass innerhalb des musikalischen und frequenzmäßigen Spektrums eigentlich bist. Auf einer Tastatur ist es außerdem viel einfacher, harmonische Zusammenhänge zu verstehen und nachzuvollziehen – du siehst einfach und klar vor dir, was du machst und wie alles zusammenhängt.
Die harmonischen Verhältnisse von Saiteninstrumenten sind viel schwieriger zu durchschauen. Bassisten und Gitarristen neigen dazu, lange – manchmal zu lange – Linien zu spielen. Auf Saiteninstrumenten ist das möglich, da es keine natürliche Grenze wie die Atmung bei Blasinstrumenten gibt.
Die Erfahrung, Saxofon und Bass-Klarinette zu spielen, gibt mir ein besonderes Gefühl für den Atem, das sich auch beim Bass-Spielen auswirkt. Ich glaube, dass viele der herausragenden Saiten-Spieler ihre Phrasen mitsingen; nicht immer hörbar, aber auf jeden Fall in ihrer Vorstellung.
Das macht deine Phrasierung natürlicher, du arbeitest automatisch mit deinem Atem und orientierst dich an einem gesanglichen Spannungsbogen. Ergebnis ist eine vokalistische Artikulation, die bestimmte Eigenarten der menschlichen Stimme nachvollzieht. Ich spiele auch Gitarre: du kannst auf allen meinen Platten Gitarren-Parts von mir hören.
Ich fing damit an, als ich noch bei David Sanborn spielte. Wir waren mitten in den Aufnahmen und wollten nicht auf den fehlenden Gitarristen warten – also spielte ich den Part. Ich bin ein guter Rhythmus-Gitarrist, wenn ich mal ein Solo spielen muss, lande ich meist bei kurzen Linien, die im Stil von Eric Gale sind.
Marcus Miller über seinen Sound
Auf der Bühne spiele ich meistens ziemlich laut, vor allem mit meiner eigenen Band. Ich brauche dieses besondere Gefühl im Bauch. Live setze ich einen Kompressor ein, der nicht immer in Betrieb ist, sondern gezielt eingeschaltet wird. Ich habe außerdem einen Mutron-Phaser, einen Oktaver und eine kleine Overdrive-Box. Normalerweise spiele ich Fingerstyle oder Slap, mit Pick hörst du mich eher selten, höchstens manchmal im Studio.
Im folgenden Video seht und hört ihr Marcus Millers Sound live auf dem Estival Jazz Lugano 2008 mit seinem Hit “Power”.
Ich kann schnell zwischen Fingerstyle und Slap wechseln. Ich habe mir nie größere Gedanken darüber gemacht, das hat sich von selbst entwickelt. Wenn du zwischen Fingerstyle und Slap wechselst, brauchst du vor allem einen sensiblen Daumenanschlag (Original: „you need a light thumb“). Ansonsten bekommst du zu große Pegelsprünge.
Wenn du Fretless spielst, ist die größte Gefahr, dass du klingst wie Jaco Pastorius. Auch mir haben schon viele Leute gesagt, sie würden ihn in meinem Fretless-Spiel raushören. Wenn du genügend Zeit intensiv und kreativ mit deinem Instrument verbringst, wirst du jedoch eine eigene Persönlichkeit entwickeln.
Heute kannst du tatsächlich in meinem Spiel bemerken, dass ich eine Menge von Jaco gehört habe. Schließlich habe ich ihn intensiv studiert. Doch ich hoffe, dass man ebenso klar hört: Das ist Marcus! Das Geheimnis ist das Vertrauen in deine eigene Vorstellungskraft. Wenn dir etwas gefällt – spiel es, egal was andere dazu sagen.
Marcus Miller über Tipps für junge Musiker
Wenn mich junge Musiker fragen, was sie für ihre musikalische Phantasie tun sollen, empfehle ich ihnen, zu singen. Außerdem ist es wichtig, sich permanent aufzunehmen und genau zuzuhören. Entwickle ein gutes Gefühl zu deinem eigenen Spiel. Sorge dafür, dass es dir Spaß macht, dir selbst zuzuhören. Arbeite an deinem eigenen Vokabular.
Viele schöne und nützliche Sachen entdeckt man per Zufall. Arbeite an den musikalischen Dingen, die du magst und strebe einen eigenen Sound an. Wenn du Aufnahmen von dir selbst hörst und das Gefühl hast, jemand anderem zuzuhören, beginnt deine Entwicklung zu einer individuellen musikalischen Persönlichkeit.
Ich übe nicht strukturiert. Eigentlich improvisiere ich. Manchmal lasse ich einen Drum-Computer laufen und spiele einfach dazu. Wenn ich auf etwas stoße, das mir Schwierigkeiten macht, denke ich mir Übungen dazu aus, die mich weiterbringen. Diese Art zu Üben entspricht meinem Live-Approach.
Im Rahmen meiner eigenen Band improvisiere ich sehr viel – also muss ich einen Weg finden, die Klänge, die ich spontan höre, sofort umzusetzen. Um die Finger geschmeidig zu halten, übe ich Skalen. Ich wärme mich langsam und sorgfältig auf. Die Improvisation ist für mich das Herz der Musik, also muss ich entsprechend üben.
Wenn es um besseres Hören geht, habe ich einen Tipp: Werfe deine Videos weg, auf denen du jemanden sehen kannst, der dir erklärt, wie du spielen sollst. Höre dir CDs an! Versuch mitzuspielen, ohne dass jemand Vorgaben macht. Vergiss Transkriptionsbücher und Notenpapier, nimm dein Instrument und spiele, was du hörst.
Viele Musiker verlassen sich zu sehr aufs Notenlesen und auf Bücher und Unterrichtsvideos. Schließe deine Augen und höre, benutze deine Ohren. Nach einer Weile wirst du einen positiven Effekt feststellen.

Marcus Miller über Miles Davis
Da gibt es eine Menge zu erzählen. Wir hatten eine großartige persönliche Beziehung, es war immer cool mit ihm. Ich war oft bei ihm zuhause, wir hingen ab, hatten wunderbare Mahlzeiten, amüsierten uns und hörten großartige Musik. Es war eine tolle Zeit. Ich denke, die Tatsache, dass ich ihn gut kannte, hat mir geholfen, die richtige Musik für ihn zu schreiben. Er war nicht nur ein Freund, sondern eine Art Mentor für mich. Er stellte mich vielen Leuten vor und gab mir alle Möglichkeiten, Musik zu komponieren, zu arrangieren und als Produzent zu arbeiten.
Miles war nicht im üblichen Sinn streng. Er hat dir einfach klar gesagt, wann er etwas nicht mochte oder unangebracht fand. Grundsätzlich hatten wir alle Freiheiten, rumzuprobieren und unserer Vorstellung freien Lauf zu lassen. Er machte keine Vorgaben oder gab dir besondere Aufgaben; er machte nur ganz klare Ansagen, was ihm gefiel und was nicht. Seine Grundaussage war: Play what you feel!
Das ist eine positive und fördernde Grundeinstellung. Es führt dazu, dass du dich selbst kennen lernst und herausfindest, was du eigentlich willst. Das war extrem hilfreich für mich. Die Leute, die mit Miles gut klarkamen, waren die Leute, die das verstanden hatten und davon profitieren konnten. Die Musiker, die mit seiner Art Probleme hatten, waren die, die immer darauf warteten, dass er ihnen sagte, was sie zu tun hätten.
Nun, wie genau er mein Bass-Spiel beeinflusste, ist schwer zu definieren. Was das Komponieren angeht: er ermunterte mich, ein anderes Vokabular auszunutzen. Ich entdeckte eine andere Art des harmonischen Denkens, während ich für ihn schrieb. Was ich damals erforschte, ist zu meinem klanglichen Markenzeichen geworden.
Die traditionelle Harmonik ist auf Terz-Intervallen aufgebaut. Mit Miles zusammen beschäftigte ich mich mit neuen Möglichkeiten der Quarten-Harmonik. Wer Quarten spielte, tat das gewöhnlich auf die Art, wie sie der Jazzpianist McCoy Tyner entwickelt hatte. Wir versuchten, andere Wege zu gehen.
Wir führten Stimmen in parallelen Quarten, um neue Akkorde zu implizieren. Das ist ein sehr interessanter Klang, der beim ersten Hören eine dunkle Charakteristik hat. Ich experimentierte lange Zeit, um musikalische Schönheit damit auszudrücken zu können. Während ich in Miles‘ Band war, pflegte er Quartintervalle auf dem Keyboard zu spielen, das auf der Bühne immer vor ihm stand.
Da bekam ich die Idee, das als Stilmittel intensiv einzusetzen – nicht nur, um eine gewisse mysteriöse, dunkle Stimmung zu erzeugen, sondern auch in ganz anderen Zusammenhängen. Es ist wirklich ein interessanter Klang und du weißt sofort: Das ist Marcus Miller.
Marcus Miller über seine Vorbilder
Miles Davis ist sicher ein Vorbild, dann John Coltrane, Larry Graham, Stanley Clarke, Jaco Pastorius, Stevie Wonder, Herbie Hancock und natürlich viele Menschen aus meinem persönlichen Umfeld. Der wichtigste ist sicher mein Dad. Ich habe auch eine politische Seite und finde Persönlichkeiten wie Martin Luther King und Malcolm X wichtig.
Musikalisch bin ich immer dann angesprochen und berührt, wenn Menschen ihr Herz und ihren Verstand im richtigen Verhältnis nutzen. Diese Fähigkeit, handwerklich gut gemachte Musik mit emotionalem Charakter zu schaffen, bewundere ich. Die Bassisten, die mich ganz konkret beeinflusst haben, sind Stanley Clarke, Larry Graham und Jaco Pastorius.
Als ich jung war und ernsthaft anfing, Bass zu spielen, versuchte ich, ihren Approach zu kopieren. Ich geriet allerdings schnell in musikalische Situationen, in denen es nicht angebracht gewesen wäre, wie jemand anderer zu spielen. Als ich zu Miles kam, wäre es Unsinn gewesen, wie Stanley Clarke zu spielen. Er wollte etwas Neues. Auch das Session-Spielen in New York hat mir geholfen. Ich spielte ganz einfach so viel, dass ich schließlich meine eigene Persönlichkeit und meinen Stil entdecken musste.
Unter den Kontrabassisten ist Paul Chambers mein Favorit. Dann gibt es noch Ron Carter oder Sam Jones. Es ist nicht einfach, auf dem E-Bass Jazz zu spielen. Viele E-Bassisten wissen nicht, was genau Swing ausmacht. Es hilft, nebenbei ein wenig Upright zu spielen und zu spüren, wie wichtig jede einzelne Note ist.
E-Bassisten tendieren dazu, den Wert einzelner Töne gering zu schätzen, da ihr Instrument im Vergleich zum Kontrabass so einfach zu spielen ist. Wenn es wie beim Upright schwierig ist, gute Töne zu erzeugen, landest du automatisch bei den wirklich wichtigen und bedeutungsschweren Noten. Wenn du Swingen möchtest, musst du in der Lage sein, über jede einzelne Note Rechenschaft abzulegen.

Marcus Miller über Producing
Das erste Album, das ich produzierte, war ein David-Sanborn-Album Mitte der 80er Jahre, oder war es eine Platte von Lonnie Liston Smith? Ich weiß es nicht mehr genau. Produzieren ist für mich eine Art Verlängerung des Song-Schreibens. Ich präsentierte den Künstlern Songs, sie baten mich, die Arrangements zu machen – und schließlich produzierte ich.
Eine natürliche Entwicklung. Ich hatte offensichtlich eine nachvollziehbare Idee, wie die Musik zu klingen hat. Außerdem kannte ich die Verhältnisse und Arbeitsprozesse im Studio. Es gab damals einen Bedarf für jemanden, der Leuten wie David Sanborn oder Luther Vandross helfen konnte, im Studio ihren Sound zu bekommen. Für mich waren das sehr vertraute Verhältnisse.
Die wichtigste Aufgabe des Produzenten ist es, einem Künstler dabei zu helfen, seinen persönlichen Sound zu finden. Das Talent des Produzenten ist dazu da, zu unterstützen. Das kann eine Menge Dienstleistungen umfassen: die Auswahl der richtigen Songs, das Aufspüren der richtigen Musiker und des passenden Studios, die Budget-Planung.
Ein besonderes Talent, das ich habe, kann dazu führen, dass ich selbst Songs schreibe, arrangiere und im Studio selbst spiele. Du sorgst einfach dafür, dass die Produktion eines Albums reibungslos über die Bühne geht und wählst dafür die passenden Mittel aus.
Bassisten sind für diese Aufgabe gut gerüstet – denke an Charles Mingus oder Jaco Pastorius, die beide großartige Arrangeure waren. Gute Arrangeure können auch gute Produzenten werden; sie haben die Klangvorstellung bereits parat und müssen nur noch die entsprechenden Studioabläufe und Technologien kennenlernen und beherrschen. Das Geheimnis ist einfach: gutes Gehör und umfassendes Grundlagenwissen. Bassisten sind daran gewohnt, auf die ganze Band zu hören. Viele Lead-Player hören nur auf sich selbst oder auf andere Lead-Player.
Marcus Miller über Technik
Ich versuche, dass die Technik die Musik nicht allzu sehr beeinflusst. Als die ersten Drum-Machines kamen und schlagartig populär wurden, hat sich die Musik zum Teil fundamental verändert. Ich merkte schnell, dass man damit vorsichtig umgehen musste. Die Gefahr ist groß, dass deine Musik klingt wie die gerade aktuellen und angesagten Maschinen.
Heute benutze ich moderne Technologie dazu, die Dinge einfacher zu machen. Wenn wir mehrere Takes einer Performance aufgenommen haben und verschiedene Teile favorisieren, ist das kein Problem mehr. Du kannst die besten Teile ganz einfach zusammenfügen, Dank leistungsfähiger Computer ist das keine große Aufgabe mehr.
Bei der Produktion von Filmmusik ist das besonders hilfreich. Da musst du manchmal kurzfristig einen neuen Part einschieben oder eine Szene wird einige Sekunden länger oder kürzer. Ich muss dann nicht mehr die Musiker zusammensuchen, sondern kann die Musik problemlos angleichen oder Teile wiederholen. Der Einsatz von Computern ist immer dann sinnvoll, wenn sie deine Arbeit erleichtern.
Marcus Miller über die Arbeit im Studio
Ich persönlich arbeite mit einer digitalen Audio-Workstation namens Paris, hergestellt von EMU-Systems. Seit kurzem benutze ich auch Logic. Dazu kommt eine Euphonix-Konsole, ein digital kontrollierter Analog-Mixer. Manchmal arbeite ich auch mit dem Mackie-Digital-Pult. Ich habe immer noch meine alte analoge Zwei-Spur, mit der ich manchmal die Rhythm-Section aufnehme – immer dann, wenn es auf einen warmen Sound ankommt.
Seit vier Jahren habe ich ein eigenes Studio in Kalifornien. Heutzutage ist die Auslegung der Studioräumlichkeiten längst nicht mehr so wichtig wie früher. Du kannst alle Arten von Räumlichkeit digital simulieren. Zum Glück ist die Erzeugung von ,good vibes‘ immer noch schwierig.
Ich arbeite viel mit Samplern, aber weniger mit fertigen Loops. Ich habe es versucht, aber es hat mich gelangweilt. Ich arbeite mit Wiederholungen, aber die Grundlage sind immer selbstgespielte Parts. Die digitale Inflation von Klängen ist beachtlich.
Man hat heute leichten Zugriff auf riesige Klang-Bibliotheken. Wenn dir ein Sound nicht gefällt, gehst du ein paar Speicherplätze weiter und findest das Gewünschte. Früher programmierten wir alles selbst, es gab nur einige Synthesizer-Modelle, die von allen Leuten benutzt wurden. Wenn du einen charakteristischen Klang wolltest, musstest du selbst programmieren.
Das hatte auch Vorteile: man versteht, wie Klänge entstehen und wie man sie verändern kann. Normalerweise versuche ich, die Rhythm-Section, also Bass und Drums, gemeinsam live aufzunehmen. Die weiteren Tracks werden in der Regel nach und nach eingespielt. Es gibt aber auch Situationen, in denen alle live im Studio spielen und die Kommunikation eine große Rolle spielt.
Wenn du z. B. Filmmusik produzieren möchtest, brauchst du als Grundlage ein breit gefächertes Vokabular. Du musst stilsicher verschiedene Stimmungen erzeugen können. Beim Film-Scoring geht es darum, die Zuschauer unterbewusst etwas fühlen zu lassen, während sie den Film sehen. Du musst mit Mitteln arbeiten, die keine echte Aufmerksamkeit auf sich ziehen, die Leute sollen sich schließlich auf den Film konzentrieren. Das ist die knifflige Sache dabei: Emotionen hervorrufen, ohne die Zuschauer aus dem Film zu reißen.
Im Moment arbeite ich an einem Film, während wir auf Tour sind. Ich habe im Hotelzimmer mein Laptop, einige Sound-Module und Mikrofone. Auf dem Computer läuft die Paris-Software und Logic, die Klangerzeuger sind ein Proteus-Modul, ein Roland JV-1080 und ein S-760-Sampler.
Der Film ist als Quick-Time-Movie auf der Festplatte gespeichert; so kann ich unterwegs Ideen sammeln und weiterarbeiten. Beim Mixdown vertraue ich auf einen guten Sound-Engineer. Ich bin eher auf die Musik selbst konzentriert, höre allerdings genau, wenn Klänge oder Lautstärkeverhältnisse unausgewogen sind.
Generell suche ich nach einem natürlichen und warmen Klang – wenn es zu digital klingt, spricht es mich nicht an. Mein Ideal ist ein voller Klang mit angenehmer Brillianz. Von meinen eigenen Produktionen mag ich jene mit Luther Vandross aus den 80er Jahren. Dann die Verbindung mit Miles – darüber bin ich rückblickend natürlich besonders glücklich. David Sanborn, Chaka Khan, Grover Washington Jr., Brian Ferry, Wayne Shorter, ich war an so vielen großartigen Produktion beteiligt.
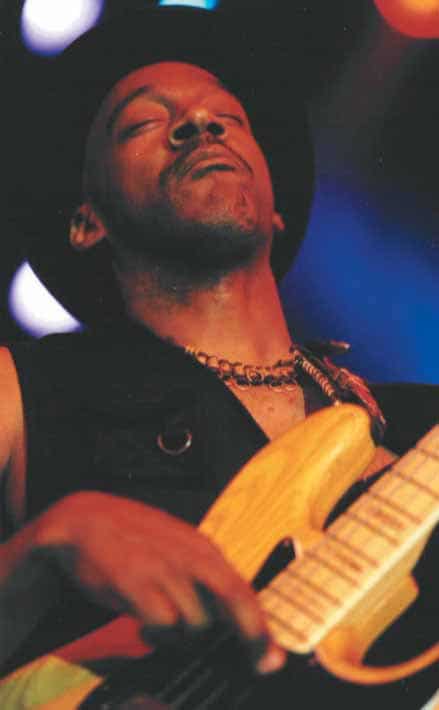
Marcus Miller über das Leben als Bassist
Mein Markenzeichen als Bassist ist mein Sound! Du hörst eine Note und weißt genau: Das ist Marcus Miller. Und das ist das Wichtigste, danach habe ich immer gestrebt. Viele Platten von Bassisten sind nur für andere Bassisten interessant. Zum Glück scheint das auf meine Arbeit nicht zuzutreffen.
Ich denke, das Geheimnis ist nicht nachlässig zu sein. Viele Bassisten lernen nicht konsequent genug, eine Begleit-Funktion einzunehmen, Rhythmus zu spielen. Sie wollen solieren. Es gibt auch den umgekehrten Fall: Bassisten, die nie ein richtiges Solo spielen wollen und es auch gar nicht könnten.
Einer meiner Favoriten, Paul Chambers, war ein großartiger Begleiter. Er spielte als Teil der Rhythmusgruppe; wenn es an der Zeit für ein Solo war, spielte er ein klasse Solo und kehrte sofort zu seiner begleitenden Rolle zurück. Ich finde, so sollte ein Bassist arbeiten, nur so bist du komplett.
Niemand würde auf die Idee kommen, einem Pianisten zu sagen: Du musst entweder ein guter Solist oder ein guter Begleiter sein. Unsinn, du musst beides sein. Und das gilt für Bassisten genauso. Warum sollte die Funktion des Bassisten eingeschränkt sein? Ich habe manchmal überlegt, ob ich eine zusätzliche hohe Saite integrieren soll. Aber hier mag ich die Beschränkung.
Ich muss härter arbeiten, und das scheint meinem Spiel zugute zu kommen. Irgendwann werde ich bestimmt einen Fünfsaiter mit zusätzlicher hoher Saite spielen. Aber es ist schwer, mit dieser dünnen Saite einen fetten Ton zu bekommen und nicht wie eine Gitarre zu klingen. Ich denke, die Schönheit der Musik hat auch damit zu tun, dass jedes Instrument seinen eigenen Klangcharakter hat.
Ich möchte nicht mit dem Bass Klänge erzeugen, die es in der Band schon gibt. Ich würde wohl nie einen Sechs-Saiter spielen – schließlich habe ich einen Gitarristen in meiner Gruppe. Wenn ich eine Möglichkeit finde, eine zusätzliche hohe Saite zu spielen, die immer noch nach Bass klingt, werde ich sicher damit experimentieren.
Marcus Miller über Drum & Bass
Ich denke, die verschiedenen Arten von Groove haben immer mit der Persönlichkeit des Drummers zu tun. Unterschiedliche Schlagzeuger haben auch unterschiedliche Herangehensweisen an die Musik. Das differiert zum Teil extrem. Es gibt so viele Möglichkeiten, wie man einen Beat spielen kann.
Ich habe mit einer ganzen Menge guter Drummer gearbeitet. Ich mag Steve Ferrone, Steve Gadd, Poogie Bell – es gibt so viele gute Jungs da draußen. Früher habe ich mich beim Zusammenspiel mit einem Drummer auf die Bass-Drum konzentriert. Heute höre ich auf das ganze Set, auf die Spielauffassung und mehr noch auf das gesamte musikalische Umfeld.
Zu dieser Hörgewohnheit hat sicher auch mein Job als Produzent beigetragen. Wenn du einem Drummer intensiv zuhörst, merkst du, dass gerade die HiHat dir sehr viel über seine Groove-Attitüde sagen kann. Es gibt nicht viele Schlagzeuger, die sowohl in der Funk- als auch in der Jazz-Welt zu den Besten gehören. Das sind völlig verschiedene Konzepte: Funk ist sehr ,tight‘, Jazz ist eher ,loose‘. Es sind verschiedene Sprachen.
Andere Instrumente können stilistische Schwächen oder rhythmische Ungenauigkeiten schon mal überspielen. Diese Möglichkeit hat der Drummer nicht. Der Drummer muss einfach genau spielen, sonst stimmt das Herz der Musik nicht.Es gibt einige Spieler, die in beiden Welten fit sind. Poogie Bell aus meiner aktuellen Band kann auch swingen, großartig sind auch Lenny White oder Billy Cobham.
Marcus Miller über Politik und das Leben
Ich habe auch eine politische Seite. Wenn du Amerikaner bist, spielt die Hautfarbe immer noch eine Rolle. Die Ereignisse vom 11. September 2001 haben die Dinge ein wenig verändert. Die Leute fingen an, weniger in den Kategorien ,Schwarz‘ und ,Weiß’ zu denken, sondern fühlten sich gemeinsam als Amerikaner. Es gehört immer noch zur Realität, dass die Chancen von Farbigen – insbesondere von farbigen Musikern – schlechter sind.
Weiße Amerikaner fühlen sich besser, wenn sie Musikern zuschauen können, die aussehen wie sie selbst. Das gilt seit Elvis. Er sang im Grunde schwarze Musik und wurde ein Star damit. Ich bin deswegen nicht verbittert, aber ich registriere diese Verhältnisse aufmerksam. Es gibt heute glücklicherweise eine Tendenz, dass Musik aus der schwarzen Community wieder geschätzt wird.
Mein Alltag ist sehr ausgefüllt und ich kann sagen, dass ich ziemlich beschäftigt bin. Ich habe vier Kinder; wir leben in Los Angeles. Normalerweise stehe ich um halb sieben auf, helfe den Kindern und fahre sie zur Schule. Dann verschwinde ich im Studio und arbeite durch bis vielleicht sechs Uhr abends. Danach gehe ich erst mal heim zum Abendessen und ausspannen.
Um neun bin ich meistens schon wieder im Studio bis nach Mitternacht. Dazwischen schaffe ich mir immer wieder Zeiten, in denen ich ganz für die Familie da bin. Ich fühle mich gut, wenn die richtige Balance zwischen Familie und Arbeit da ist. Leider kann ich die Kids nicht mit auf Tour nehmen, da es sie aus dem Schulbetrieb reißen würde. Ich möchte nicht, dass meine Kinder ein Leben haben, bei dem sie ständig unterwegs sind.
Ich habe hier noch ein paar Musik-Tipps: Zu meinen Lieblings-Platten gehören Herbie Hancocks ‚Headhunters‘, Grover Washingtons ‚Mr. Magic‘ und ‚Kind Of Blue‘ von Miles Davis. Außerdem mag ich Sly And The Family Stone und die Jackson Five.
John Coltrane ist auch ein Favorit. Ich mag die Phase, als er seine spirituellen Melodien schrieb und solche Stücke wie ‚Naima‘, ‚Lonnie’s Lament‘ oder ‚Crescent‘. Das war seelenvolle Musik. Ich habe noch einige Lieblings-Gitarristen, die ich gerne höre: George Benson, Eric Gale, Bill Frisell, Allan Holdsworth, und es gibt einige coole Funk-Gitarristen wie Nile Rodgers oder Dean Brown.
Marcus Miller über die Dokumentation „Marcus, The Film“
Nun, einige Leute kennen mich als Musiker für Miles Davis, andere kennen mich als Studiomusiker, wieder andere als Filmmusik- Komponist. Und manche nur als Bassist. Hier versuche ich mich als Mensch und Musiker ganz vorzustellen. You get to see the whole thing! Und dann dürft ihr euch fragen: wie schafft der das? Wann schläft der Mann? (lacht)
Marcus Miller über Bassisten von heute
Ich glaube die große Zeit der virtuosen Bassisten ist unwiederbringlich vorbei. Wenn du in den Siebzigern ein erfolgreicher Bassist werden wolltest, musstest du eine Menge Zeit aufbringen, und dir eine Menge Scheiß draufschaffen, egal ob du Jazz, R&B oder Soul spielen wolltest. Der Standard war sehr hoch. Denn die guten Jungs da draußen hatten es drauf: Jaco Pastorius, Alphonso Johnson, Anthony Jackson, Larry Graham – sie gaben den Standard vor.
Sie haben die Leute durch ihren Groove zum tanzen gebracht. Solche Bassisten gibt es nicht mehr. Wo in der gegenwärtigen Pop-Musik spielt der Bass heute eine Rolle? Viele junge Bassisten verstehen die Verantwortung nicht die der Bass hat, geschweige, dass sie überhaupt eine Ahnung haben wie man groovt.
In den Siebzigern war der Bassist derjenige, der den Laden zusammenhielt. Die Drummer dachten zwar immer, sie seien das, aber wir wussten, dass wir es sind! (lacht) Das verlangt Persönlichkeit, Musikalität und die Fähigkeit das Potential eines Songs zu erkennen. Wenn du heute junge Bassisten auf YouTube siehst, hocken die in ihrem Zimmer und spielen den Bass wie eine Gitarre. Die Persönlichkeit der Bassisten hat sich grundlegend verändert. Und damit auch der Bass in der Musik, ganz klar.
Junge Bassisten betrachten ihr Instrument heute eher als Soloinstrument, was ja okay ist, wenn sie zuerst Mal die Basics drauf hätten: Timing, Groove, Zusammenspiel, Ton. Aber sie greifen den Dingen vor, anstatt sich zuerst die fundamentalen Grundlagen draufzuschaffen. Vielen fehlt es heute an musikalischem Verständnis.
Marcus Miller über das Geheimnis seines Spiels
Ich übe, jeden Tag. Ich höre auch zu, jeden Tag. Ich beschäftige mich mit neuen Techniken, die ich für Interessant halte. Ich lerne neue Instrumente wie die Gimbri, die ich in Afrika entdeckt habe. Ich lerne selbst Dinge, auch wenn ich nicht unbedingt auf die Musik stehe. Aber das ist eine andere Geschichte und letztlich nur eine Frage der Adaption.
Etwa Tappping-Geschichten. Das ist jetzt schon wieder ein alter Hut. Oder Legato-Techniken. Auf einem Jazz Bass mit hoher Saitenlage ist das eine echte Herausforderung! Aber es ist Wert, den Gedanken zu verfolgen. Ich übe immerzu. Der Bass ist noch immer ein verhältnismäßig junges Instrument. Es gibt vieles zu entdecken. Jeder Musiker sollte an sich arbeiten. Und sein Spiel reflektieren.
Der größte Teil ist Technik, klar. Hast du mal ‚Whiplash‘ gesehen? Diesen Film über einen jungen Schlagzeuger in einem Jazz-Ensemble, dessen Lehrer ein echt harter Hund ist. Er tyrannisiert ihn permanent und es kommt zu vielen zwischenmenschlichen Konflikten. Ein preisgekrönter und interessanter Film. Jedenfalls kann unser Schlagzeuger das Tempo nicht halten, weil er mit zu viel Kraft spielt.
Er übt wie ein Verrückter bis seine Hände bluten. Bis ihm ein Kollege rät: Dude, das ist der falsche Weg. Du musst locker sein, wenn du schnell spielen willst! So ist es auch mit dem Bass. Im Studio schlage ich die Saiten ganz sanft an, ohne Kraft, denn sie sollen schön ausschwingen, nur dann klingt es gut. Live ist eine andere Geschichte, da lasse ich mich von der Energie mitreißen.
Marcus Miller über die perfekten Basssaiten
Ich möchte wieder einen etwas aggressiveren, präsenteren Sound, wie ich ihn etwa 1979/80 hatte. Mein Ton ist bekanntlich sehr rund und voluminös in den tiefen Frequenzen, etwas zurückhaltender in den Mitten und obendrauf kommen sehr obertonreiche, klare Höhen.
Jetzt möchte ich die Mitten wieder ein wenig stärker betonen. Es war an der Zeit, gerade für ‚Afrodeezia‘. Ich muss die Band zusammenhalten, damit die Zuhörer sich auf die Perkussion einlassen können. Ich fand es toll, wie enthusiastisch die Jungs diese Saiten entwickelt haben und das Resultat klingt echt cool.
Marcus Miller über Rhythmusgefühl
Ob du Rhythmusgefühl besitzt, kriegst du als Kind schnell mit. Ich habe meine Eltern tanzen sehen, als ich klein war. Und sie haben auch mit mir getanzt. Wenn mein Vater bei einem Geburtstag Klavier gespielt hat, rief er mich und meinte: Komm Marcus, tanz für deine Tanten! Und ich habe getanzt. Wenn du in einem kulturellen Umfeld aufwächst, in dem Bewegung und Tanz essentiell sind, ist das Teil deiner Persönlichkeit.
Ich bin oft gefragt worden, ob Schwarze und Weiße eine unterschiedliche Auffassung von Rhythmus hätten. Ich finde, dass es keine Frage der Hautfarbe ist, sondern der kulturellen Herkunft. Wenn du als schwarzer Teenager nicht tanzen konntest, hast du dich auf keine Party getraut! Und was haben wir Jungs als erstes auf einer Party gemacht? Wir sind gemeinsam aufs Klo gegangen und haben unsere Dance-Moves gecheckt! (lacht)
Marcus Miller über seinen Sire V7 Signature Bass
Ich arbeite jetzt mit dem koreanischen Basshersteller Sire zusammen, der einen qualitativ unglaublich hochwertigen Bass für mich gebaut hat, den V7 Signature, der unter 500 Euro zu haben ist. Unglaublich, oder? Ich wollte einen Bass, der auch für Einsteiger erschwinglich ist. Und der Sire ist eine tolle Möglichkeit. Und weißt du was: Einige meiner Freunde in New York spielen den auch schon!
Er hat ein Jazz-Bass-Shaping, der Hals ist jedoch ein bisschen mehr im Sixties-Style. Du kannst ihn passiv oder aktiv spielen und allein der passive Sound ist schon cool. Er hat die Heritage-3 Elektronik, hat Volume- und Tonregler als Dual Potis, hat einen Tonabnehmer-Mischregler, einen für die Höhen und einen Regler für die Mitten. Er bietet dir eine Menge Möglichkeiten.
Gerade die Mitten sind mir wichtig, wie schon beim Thema Saiten erwähnt. Es ist schwierig einen neuen Bass zu finden, wenn du für einen bestimmten Sound bekannt bist. Da kannst du nicht plötzlich die Revolution ausrufen, das würde mein Publikum nicht verstehen. Aber ich kann meinen Sound finetunen, um mich weiterzuentwickeln.
Das Live-Gear von Miller:
Das folgende Video vom North Sea Jazz Festival 2015 zeigt Marcus Miller mit seinem Song “Blast”:
https://www.youtube.com/watch?v=gngaicI3iXc
Marcus Miller über seinen Hut
Ha! Die Jazz-Cats der 40er-Jahre trugen auch solche Hüte, das war einfach cool. Thelonious Monk trug Hut, Lester Young war berühmt für seinen. Charles Mingus schrieb sogar das Stück ‚Goodbye Pork Pie Hat‘ für Lester. Ich habe vor 20 Jahren meinen Hut gefunden, fand ihn cool und hab ihn auf Album-Covern getragen – und heute ist er ein Teil von mir. Aber weißt du was? Wenn ich nicht erkannt werden will, setze ich ihn ab. Das funktioniert tatsächlich. Ohne Hut erkennt mich niemand! (grinst) Aber nicht weitererzählen …
Die Aussagen stammen aus mehreren Interviews mit Marcus Miller, die in Gitarre & Bass erschienen sind.
Album Afrodeezia (2015)
Schon der Opener mit afrikanischem Scat-Gesang und polyrhythmischer Ausrichtung stellt gleich mal Album-Titel und Unterhaltungsschwerpunkt klar: ‚Afrodeezia‘ heißt das 2015 erschienene Werk der New Yorker Bass-Legende Marcus Miller. Eine illustre Schar Gastmusiker aus Mali, dem Senegal und Burkina Faso begleitet ihn, Instrumente wie Kalimba, Gimbri und Kora sorgen für Klangfarben vom großen Kontinent.
Als Konzept steht eine musikalische Reise hinter diesem Longplayer, die 2012 mit dem Track ‚Gorée‘ auf Millers Album ‚Renaissance‘ begann. ‚Gorée‘, vor der Küste Senegals, war einst als Sklaveninsel berüchtigt. Hier begann Millers Spurensuche, die ihn von Afrika über Brasilien nach Trinidad und in den Süden der Vereinigten Staaten brachte. Ein Projekt, für das ihn die UNESCO als „Künstler für den Frieden“ ehrte.
So wie Marcus Miller den Weg der afrikanischen Musik durch die Welt auf ‚Afrodeezia‘ reflektiert, entstehen daraus natürlich Fragen zu Rhythmik, Phrasierungen, Ton und auch den Instrumenten – Parameter die sich für Miller stetig weiterentwickeln müssen. Nicht umsonst hat er für dieses Album die afrikanische Kastenhalslaute Gimbri gelernt.

Marcus Miller Diskografie
- Suddenly (1983)
- Marcus Miller (1984)
- The Sun Don’t Lie (1993)
- Tales (1995)
- Live And More (1998)
- M_ (2001)
- The Ozell Tapes – Official Bootleg (2002)
- Panther Live (2004)
- Silver Rain (2005)
- Free (2007)
- Marcus (2008)
- A Night in Monte Carlo (2010)
- Renaissance (2012)
- Afrodeezia (2015)
- Laid Back (2018)